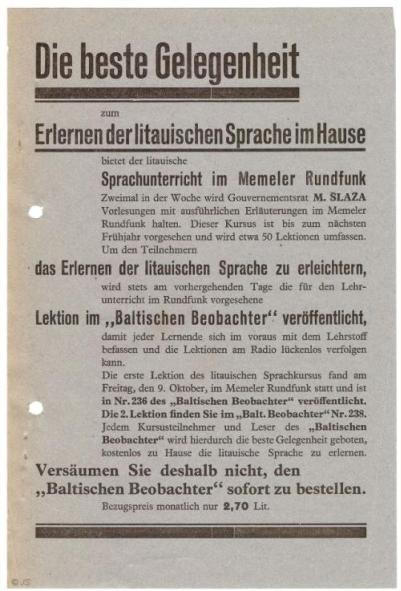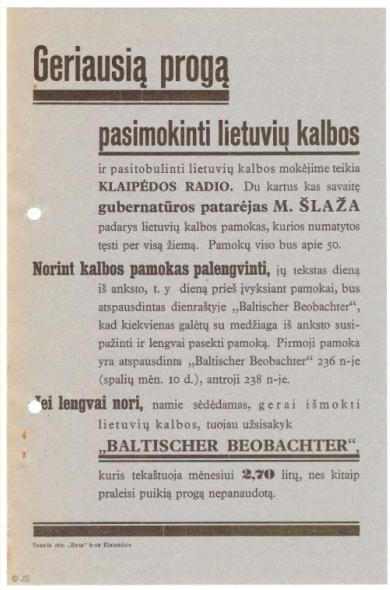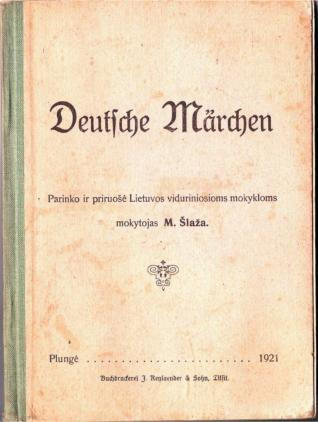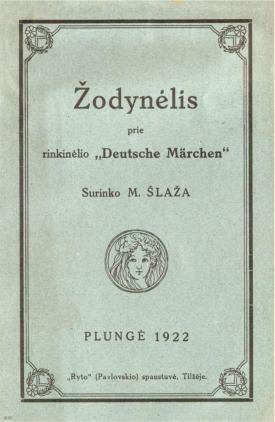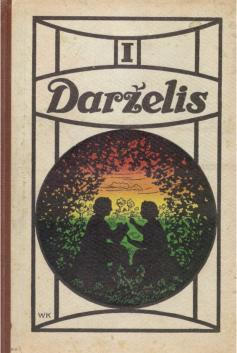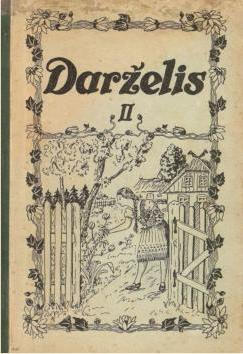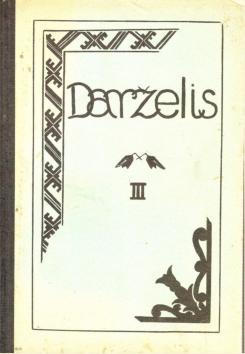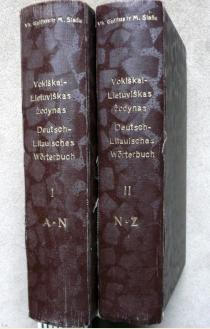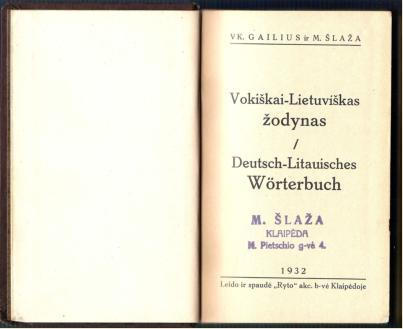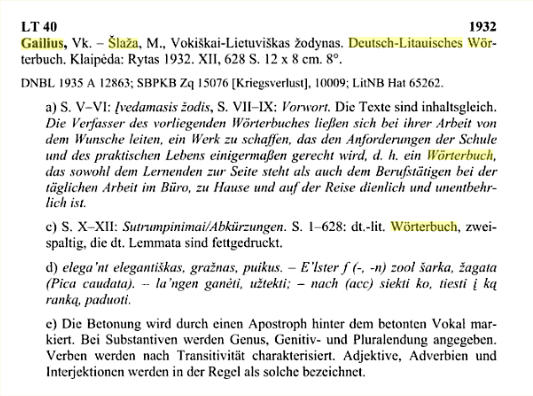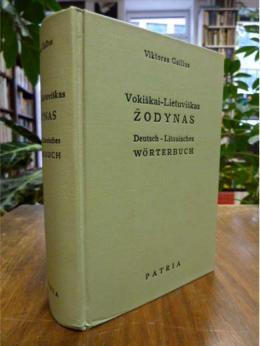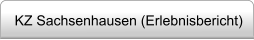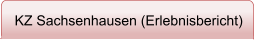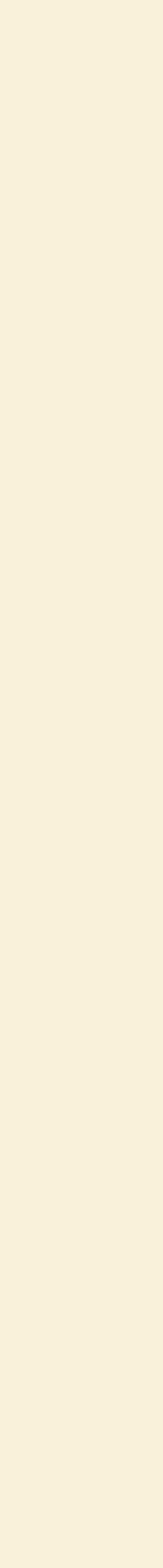


Zur Person Mikas Šlaža
Mikas Šlaža ist am 23. Juni 1897 in Deutsch-Crottingen geboren. Im
Geburtsregister der evangelisch-lutheranischen Kirche der damaligen
Kirchengemeinde Crottingen ist eingetragen, dass die Eltern des
Kindes der Losmann Martynas Šlaža und seine Frau Marinke,
geborene Makareinytė, waren. Ein Losmann war ein Mann ohne
Grundbesitz, ein Landloser. Er lebte nur von der Arbeit seiner Hände.
Diese Leute siedelten sehr oft auf der Suche nach Brot und Löhnung
von einem Ort zum anderen. Sehr schnell, wahrscheinlich nach der
Geburt des Kindes, siedelten die Eltern aus dem Teil Litauens, der
unter der Zarenregierung des damaligen Russland stand, in das
kaiserliche Litauen.
Sie ließen sich nahe Deutsch-Crottingen in dem Ort Lankučiai (in den
deutschen Melderegistern heißt dieser Ort Lankutten) nieder. Mikas
Heimat war also Lankučiai. Diese Umgebung war ganz litauisch – hier
auf dem Lande lebten nur litauische Bauern. Deutsche konnte man nur
im Zentrum von Deutsch-Crottingen treffen. Meistens waren es Lehrer
oder Pfarrer, Polizisten oder Postbeamte, manchmal auch
Ladenbesitzer oder Gutsbesitzer. Von 1904 bis 1911 lernte der Junge
in der Volksschule in Deutsch-Crottingen. Der Gebrauch der
litauischen Sprache war hier sogar während der Pausen verboten.
Mikas zeichnete sich unter seinen Altersgenossen durch gutes
Gedächtnis aus, er las viel und war gelehrig. Aber seine Anfangsbildung war nicht besonders hoch. Wegen
der Armut konnte die Familie den Jungen nicht auf das Gymnasium oder eine Hochschule schicken. Die
einzige Möglichkeit war damals das evangelische Missionsseminar oder das Lehrerseminar, wohin die
jungen Litauer oftmals strebten. Die Familie von M.Šlaža war nicht besonders religiös, weshalb der Vater
von dem Schulleiter leicht überzeugt werden konnte, dass man seinen Sohn ermutigen solle, Pädagoge zu
werden. Den zukünftigen Beruf konnte er in Memel im Lehrerseminar lernen. Aber zuerst, wie auch die
anderen Jungen, die nur Anfangsbildung besaßen, sollte Mikas drei Jahre die sogenannte
Vorbildungsschule – die Präparandenanstalt – in der Hafenstadt besuchen. Nachdem die Prüfungen
abgelegt waren, ging Mikas ins Seminar seines Heimatortes. Hier wurden die Lehrer für die Volksschulen
ausgebildet. Die weitere Ausbildung im Lehrerseminar in Memel dauerte hier vier Jahre. Die Ausbildung
erfolgte in Psychologie und Pädagogik, Religion, Orgelspiel, Chortheorie und -praxis – alle diese Fächer
wurden unterrichtet, damit die Jungen später in der Kirchengemeinde nicht nur Lehrer, sondern auch
Organisten und Erzieher sein konnten. Die Lehrveranstaltungen fanden in deutscher Sprache statt, die
litauische Sprache wurde nur zwei Stunden in der Woche unterrichtet.
Der 1. Weltkrieg unterbrach das Studium im Seminar. Als die Zarenarmee Memel besetzte, wurde die
Schule nach Osterode (Ostpreußen) verlegt. Hier, weit von der Heimat, war das Leben schwer und darum
kam M.Šlaža im Jahre 1915 im Februar nach Hause zurück. Hier mangelte es an Lehrern. In Deutsch-
Crottingen bekam er einen Arbeitsplatz in der Schule, wo er zwei Jahre auch der Leiter der zweiten Klasse
war. Leider konnte er den Dienst in der kaiserlichen Armee nicht umgehen. Er wurde im Juni 1917
eingezogen und war bis zum 20.12.1918 als Eisenbahnpionier beim II. Ersatzbatallion des Eisenbahn-
Regiments 1 in Berlin-Schöneberg.
In den Friedenszeiten zweifelte M.Šlaža nicht, was er weiter machen sollte. Er entschied, sein ganzes
Leben der Pädagogik zu widmen. Sein erster Arbeitsplatz war das neugegründete Realgymnasium in
Plungė (Groß-Litauen). Heute ist schwer zu sagen, warum M.Šlaža sich für diesen Ort entschied. In
Plungė war er als Lehrer vom 01.09.1919 bis 20.02.1923 tätig – so bezeugen es die Dokumente. Er
unterrichtete die deutsche Sprache, nahm am öffentlichen Leben teil und verkehrte mit den einheimischen
Intellektuellen. In der Zeit, als es eine reale Hoffnung gab, das Memelgebiet der Republik Litauen
anzugliedern, nahm der Lehrer M.Šlaža auch an diesen Ereignissen teil. Der Versailler Vertrag, in dem
diese Vereinigung Litauens verkündet wurde, gab vielleicht auch ihm als Lehrer Mut, politisch aktiv zu
werden, um so mehr, als die inneren und ausländischen politischen Kräfte gegen die Verwirklichung dieser
Akte Widerstand leisteten. Eingeladen von führenden Persönlichkeiten der litauischen politischen
Bewegung im Memelgebiet, kam M.Šlaža im Januar 1923 nach Memel, wo er zum Geschäftsführer (und
Mitglied) des Zentralausschusses zur Verteidigung des Memelgebietes ernannt wurde. Es gibt ein Foto
aus dieser unruhigen Zeit. M. Šlaža steht hier zusammen mit den Führern des Zentralausschusses M.
Jankus und J. Vanagaitis. Diese politische verantwortliche Stellung veränderte wesentlich das zukünftige
Leben des Lehrers.
M.Šlaža kam nach Memel zurück und am 15. Mai 1923 wurde er Lehrer an der Grundschule Memel. Diese
Stellung wurde von V. Gailius, der damals das Direktorium des Memellands leitete, bestätigt. Dieses
Direktorium schenkte große Aufmerksamkeit der Reform des Bildungssystems. Bald darauf begann
M.Šlaža die litauische Sprache im deutschen Luisengymnasium und auch an der Präparandenanstalt des
Lehrerseminars zu unterrichten. Ab September 1925 hatte er die Stellung des Oberlehrers. Ab 1.
September 1938 unterrichtete er die litauische Sprache im Großfürst Vytautas Gymnasium. Hier war er
auch als Oberlehrer tätig.
M.Šlaža war eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und ein talentvoller Organisator. Nach dem Krieg
gründete er in Memel zusammen mit anderen Intellektuellen einen Verein zur Förderung der Volksbildung.
Ihren Statuten nach ist zu schließen, dass diese Leute Kultur und Bildungsarbeit betreiben wollten. Als der
von der breiten Öffentlichkeit und von der Regierung Litauens unterstützte leistungsfähige Kulturverband
„Opferstätte“ („Aukuras“) gegründet war, eröffneten sich größere Möglichkeiten. M.Šlaža arbeitete in
verschiedenen Kommissionen der Vereinsverwaltung mit den berühmtesten Schriftstellern, Malern,
Wissenschaftlern jener Zeit zusammen und hielt Vorlesungen mit anderen Intellektuellen. Da es an
künstlerischen Leitern mangelte, trat M.Šlaža als Chorleiter in den Dienst der Bühnenamateurvereinigung
„Aida“. Im Jahre 1933 wurde er zum Stellvertreter des Vorsitzenden (A. Brakas) dieser Vereinigung
gewählt.
Die tiefsten Spuren hat M.Šlaža im Bildungsbereich hinterlassen. Die Dienststellungen in diesem Gebiet
wurden ihm nicht nur von der Regierung zugewiesen, sondern er wurde auch von Organisationen gewählt.
Besonders fruchtbar war die Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller J. Žilius der von 1925 an als
Generalgouverneur des Memellandes tätig war. Von einem höheren Regierungsmitglied der Republik
Litauen wurde M.Šlaža zum Obersekretär des Generalgouverneurs ernannt. Sein wichtigstes
Tätigkeitsgebiet war die Bildung, d.h. die Organisierung des muttersprachlichen Unterrichts und die
Versorgung mit litauischen Lehrbüchern. Als Sekretär arbeitete er 3 Jahre. Noch einmal half M.Šlaža der
Gouverneursanstalt in den Jahren 1935-1938, als die Regierung Litauens, die um ihren Einfluß im
Memelgebiet fürchtete, die Hitlerbewegung einzuschränken begann und auch die gegen den Staat
gerichtete Tätigkeit von deutschen Lehrern schärfer kontrollierte.
Als Schulrat für das Bildungswesen im Memelgebiet (1935-1938) war M.Šlaža für die Stärkung der
litauischen Sprache und der Methodik des fremdsprachlichen Unterrichts tätig. Hier gab es viel zu tun.
Doch in diesem Bereich mehr zu erreichen, war nur möglich durch Bildung der Öffentlichkeit. Systematisch
gestaltete M.Šlaža einen Kurs der litauischen Sprache im Radio Memels (siehe Originaldokumente).
Zweimal in der Woche regelmäßig übertragene Lektionen erreichten viele Hörer. Dieser Kurs war nicht nur
für Leute, die kein Wort litauisch konnten, sonder auch für solche, die die litauische Sprache verbessern
wollten, geeignet.
Die Themen dieser Sendungen wurden sehr schnell breiter. Aus den noch vorhandenen Aufzeichnungen
kann man ersehen, dass in litauischer Sprache über die Erziehung und Bildung der Jugend und über die
Kulturgeschichte Memels und in deutscher Sprache über die Folklore Klein-Litauens und über wichtige
Probleme des öffentlichen Lebens gesprochen wurde.
Hier einige Sendungen in deutscher Sprache, zu denen Manuskripte existieren:
Der litauische Strand (Sendung am 20.05.1937)
Gegenwartsforderungen an die Schule im Memelgebiet (am 30.11.1937)
Kulturelle Rückschau auf 1937 (am 04.01.1938)
20 Jahre unabhängiges Litauen (am 16.02.1938)
Der Beschluß des Ministerrates vom 29. Dezember 1938 (am 31.12.1938)
Das kleinlitauische Volkslied (am 12.01.1939)
Kleinlitauische Märchen und Sagen (am 19.01.1939)
Das kleinlitauische Sprichwort (am 09.02.1939)
Das kleinlitauische Rätsel (am 23.02.1939)
M.Šlaža war ein begabter Publizist. Die Ausstrahlung, die von seinem Auftreten und von seinen Berichten
ausging, erreichte er durch gute Kenntnisse in seinem Fach, klare Darlegung des Stoffes, bildreiche
Sprache und fleißige journalistische Arbeit. Für die öffentliche Presse begann der Lehrer noch in Uniform
zu schreiben. Die erste bekannte Publikation wurde im Herbst 1918 in der memelischen Zeitung
„Lietuviška ceitunga“ veröffentlicht. Es waren Überlegungen eines jungen Menschen über die Zukunft des
Landes. Die Begabung und der Enthusiasmus des jungen Journalisten wurden sehr schnell von den
litauischen Kulturschaffenden bemerkt. Sie luden M.Šlaža im Jahre 1919 in die Redaktion „Rrūsų lietuvių
balsas“ („Die Stimme der Preußisch-Litauer“) nach Tilsit ein. Dort bereitete der junge Mann den Stoff für
die Presse vor. Als die Redaktion nach Memel umzog, wurde M.Šlaža gleich danach zum
Redaktionsgeschäftsführer bestimmt. Er war auch der offizielle Herausgeber dieser Zeitung. In Plungė
begann M. Šlaža in „ELTA“ als Berichterstatter mitzuarbeiten. Die Themen und den Schreibstoff bot ihm
das alltägliche Leben. Eine der besten Arbeiten über die Bildung ist sein Artikel „Das Lehrerseminar
Memels“. Hier wird ein Überblick über den Gang der Pädagogenausbildung in dieser Anstalt und über das
Lehrprogramm gegeben. Die Pädagogen Litauens konnten aus diesem Artikel die Besonderheiten des
Seminars erfahren, dessen Tätigkeit nach den Bildungsbestimmungen Preußens reglementiert war.
In seinem Artikel „Wer sind die Einwohner Klein-Litauens?“ entgegnete M.Šlaža schroff der hartnäckig
verbreiteten Meinung über das Deutschtum des Memellandes. Der Autor zeigte die nationale Schichtung
im Laufe der Jahrhunderte und bewies überzeugend anhand der offiziellen statistischen Angaben und der
Einwohnerliste, dass der Anteil der Litauer hier 50 %, der Deutschen 45,2 % und der anderen 4,1 %
betrug. In den Versammlungen des Vereins „Aukuras“ („Die Opferstätte“) gelesene oder durch das Radio
übertragene Vorlesungen wurden später als Artikel gedruckt und in „Die Nationalschule“, in den
Regionalzeitungen und in anderen Druckwerken veröffentlicht. Die publizistische Tätigkeit wurde noch
aktiver, als M.Šlaža der Redakteur der Zeitschrift „Pajūris“ („Die Küste“) war. Dieses Druckwerk
propagierte und stellte das Küstenleben Litauens dar. Darum war die Zeitschrift gut illustriert und man
konnte Artikel mit den populärsten wissenschaftlichen Erkenntnissen finden. M.Šlaža begann diese
Zeitschrift ab Nr. 5, die er redigierte, bis zum Jahre 1937 herauszugeben.
Der größte Teil seiner schöpferischen Arbeit bestand aus der Vorbereitung und der Herausgabe von
Lehrmitteln. Schon in Plungė stellte der Lehrer den Mangel an Lehrbüchern fest. Um den jungen
Menschen zu helfen, hat er zwei Bücher vorbereitet und herausgegeben. Es waren zwei deutsche
Lehrbücher – die deutsche Märchensammlung „Deutsche Märchen“ (1921) und „Wörterbuch zur
Sammlung deutscher Märchen“ (1922). Die beiden Bücher sind in Tilsit gedruckt worden.
Viel schwieriger war die Lage der litauischen Sprache im Memelland. Obwohl die litauische Sprache als
Staatssprache 1923 anerkennt wurde, beherrschte die Mehrheit der Beamten des Bildungsressorts die
litauische Sprache nicht. Autonome deutsche staatliche Behörden ignorierten die litauische Sprache.
Anderseits konnte man auf schnelle Veränderungen nicht hoffen, weil Lektoren der litauischen Sprache
und Literatur fehlten. Da M.Šlaža die Bedürfnisse der Gesellschaft und die Verantwortung spürte, machte
er sich an das erste Lehrbuch des Litauischen der Nachkriegszeit. Sein „Elementarbuch der litauischen
Sprache“ erschien 1924. Der zweite Teil dieses Buches erschien 1930.
Betrachten wir seine Tätigkeit unter den Bedingungen des damaligen Zeit, so hat M.Šlaža eine
monumentale Arbeit durch die Schaffung des Lehrbuches der litauischen Sprache für litauische Schulen
des Memellandes, das aus mehreren Teilen bestand, geleistet. Der Anfang dieser Arbeit liegt im Frühjahr
1923, als die Abteilungsleiter für Ausbildung und andere Personen einen Auftrag bekommen hatten, ein
Lesebuch für mittlere und höhere Klassen der Grundschulen zu erarbeiten. Es erschien noch in dem
selben Jahr. Dieses Buch wurde aber von der Öffentlichkeit nicht angenommen, so dass im Mai 1924 eine
neue Ausschreibung für ein neues Lehrbuch erfolgte. Nach einem Jahr bekam die Bewertungskommission
zwei Arbeiten: eine von M.Šlaža und eine von M. Kaulis, dem Lehrer aus Karkelbeck. Das Manuskript des
ersten Autors wurde als besser anerkannt. M.Šlaža erhielt das Angebot, sein Manuskript zu
veröffentlichen. Das Buch erschien im Herbst 1926 aus den Geldmitteln des Autors. Das Elementarbuch
hatte den Titel „Darželis“ („Das Blumengärtchen“). Das Lehrbüchlein war für jüngere Klassen bestimmt. Es
bestand aus dem Alphabet und einfachen Lesetexten. Die Pädagogen haben „Darželis“ hoch eingeschätzt.
Von Erfolg gekrönt, hat M.Šlaža den zweiten (1934) und den dritten Teil (1937) verfasst. Das waren
umfangreiche Schulchrestomathien für mittlere und höhere Klassen, methodisch sehr gut aufgebaut. Das
Direktorium bestätigte alle drei Teile von „Darželis“ als Lehrbücher für Schulen des Memellandes. Deshalb
entstand eine große Nachfrage. Insgesamt wurde der erste Teil von „Darželis“ viermal, der zweite Teil
zweimal, der dritte Teil einmal herausgegeben. Mit der hohen und ständig ansteigenden Auflage des
Buches fand M.Šlaža Anerkennung und wurde zu einem der bekanntesten Lehrbuchautoren in Litauen in
der Zwischenkriegszeit.
Die Sammlung und die Veröffentlichung des lexikografischen Materials waren unvermeidliche
Begleitumstände beim Verfassen dieser Lehrbücher. Als M.Šlaža bereits eine größere Menge
lexikografischen Stoffes zusammenhatte, begann er 1924 mit der Ausarbeitung eines Deutsch-Litauischen
Wörterbuches, das den Interessen einer breiten Bevölkerungsschicht entsprach. Parallel dazu arbeitete
auf dem gleichen Gebiet Viktoras Gailius. Beide haben sich für eine Zusammenarbeit entschieden. 1930
hat M.Šlaža den Vertrag mit V. Gailius unterschrieben und das Wörterbuch für die Drucklegung
abgegeben. Das Buch wurde in einer Auflage von 4.000 Exemplaren im Sommer 1932 herausgegeben.
Es hat 628 Seiten und umfasst etwa 35.000 Wörter und Wendungen, manche Wörter hatten bis zu 50
Erläuterungen. Nach dem 2. Weltkrieg ist der größte Teil dieses Wörterbuches verloren gegangen.
Die Bibliographie „Deutschlernen in Russland und in den baltischen Republiken vom 17. Jahrhundert“ von
Helmut Glück und Yvonne Pörzgen, herausgegeben im Otto-Harrassowitz Verlag 2009, befasst sich mit
Materialien für den Deutschunterricht, die vom 16. Jahrhundert bis 1941 in Russland, Estland, Lettland und
Litauen verfasst und benutzt worden sind. Dort findet man auch das oben erwähnte Deutsch-Litauische
Wörterbuch.
Das
Deutsch-Litauische
Wörterbuch
von
M.Šlaža
und
V.
Gailius
hat
nicht
nur
in
ganz
Litauen,
sondern
auch
im
Ausland
seine
Verbreitung
gefunden.
Das
Werk
wurde
von
den
Fachleuten
sehr
positiv
eingeschätzt.
Im
Wörterbuch
angehäuftes
Sprachgut
wird
auch
heute
noch
als
deutsch-litauische
lexikografische Quelle benutzt.
Auf
der
Grundlage
dieses
Wörterbuches
wurde
später
von
Viktoras
Gailius
eine
neue
erweiterte
Variante
vorbereitet,
die
1948
in
Westdeutschland
im
Verlag
Patria,
Tübingen
herausgegeben
wurde.
Bei
dieser
Veröffentlichung
wurde
der
Mitautor
M.Šlaža
schon
nicht
mehr
genannt.
1932 wurde die Lehrergesellschaft des Memelgebietes gegründet.
M.Šlaža war ihr Hauptorganisator und ihr ständiger Vorsitzender. Im
Laufe von drei bis vier Jahren hat die Gesellschaft eine Mitgliederzahl
von 170 erreicht. Die Tätigkeit ihrer Mitglieder bezog sich auf die Lösung
der Fragen der sozialen und rechtlichen Sicherung der Lehrer sowie der
weiteren Entwicklung der litauischen Kultur und Ausbildung. Ihre
Mitglieder hielten Vorlesungen und haben der Regierung Hilfe bei der
Vorbereitung und Ausarbeitung der Bildungsgesetze geleistet. Der
bedeutendste Verdienst dieser Gesellschaft ist die Herausgabe von 11
Büchern, deren größter Teil Lehrbücher und Notenblätter für Chöre
ausmachen. Diese Lehrbücher ersetzen die alten und die aus
Hitlerdeutschland eingeführten Lehrbücher.
Die ganze Verlagsarbeit hielt M.Šlaža in seiner Hand. M.Šlaža's Veranlagungen und seine Weltan-
schauung reiften in harter Arbeit und in einer ununterbrochenen Bildung. Anteil daran hatte auch sein
feinfühliges Reagieren auf jeden Impuls aller unterschiedlichen Kulturen, die sich auf dieser multilateralen
Küstenregion verflochten hatten. Sein großes Wissen schöpfte er ständig aus den Quellen der Literatur
und dem reichen Erbe des geistigen Lebens von Klein-Litauen.
Mit dem Einmarsch der Hitlertruppen in das Memelgebiet wurde die erfolgreiche Arbeit von M.Šlaža
unterbrochen. Er hatte seinen Arbeitsplatz im Lehrerseminar aufgegeben und verließ am 15. Januar 1939
auch das Gymnasium Vytautas des Großen. Er musste sich von Neuem in Kaunas einrichten und ein
passendes Beschäftigungsfeld suchen. Seine guten Deutschkenntnisse und Journalistenerfahrungen
halfen ihm. Seit dem 16. Dezember 1939 gab er die Informationszeitschrift „Lithuania-Press“ in deutscher
Sprache heraus, die für das Ausland bestimmt war und unterrichtete an der Volksuniversität. In der
Befürchtung, dass er im damaligen Litauen auch den stalinistischen Repressionen unterworfen werden
konnte, entschloss M.Šlaža sich, wieder in das Memelgebiet zurückzukehren. Seit März 1941 fand der
Lehrer und seine Familie Unterkunft in seinem Heimatdorf Lankutten. Von hier aus versuchte er, einen
Arbeitsplatz zu finden. Das gelang ihm aber nicht. Als er Tilsit besuchte, wurde er am 8. Mai 1941 von der
Gestapo verhaftet. Die Gestapo beschuldigte den Lehrer, litauisch-nationale Interessen im Memelgebiet
ausgeübt zu haben, was einem Verrat am dritten Reich gleichkam. Den Wortlaut des Schutzhaftbefehls
teilte M.Šlaža seiner Familie in einem Brief vom 8.Juli 1941 aus dem Gestapo-Gefängnis in Tilsit mit. Er
wurde ohne Gerichtsprozess verurteilt und in das KZ Sachsenhausen gebracht und seine Familie – Frau
Anna, Tochter Ruta und Sohn Jurgis – nach Deutschland ausgewiesen. Während seines Aufenthaltes im
KZ Sachsenhausen versuchte er ständig Kontakt zu seiner Familie zu halten. Davon zeugen insgesamt 82
erhaltene Briefe, die er von 1941-1945 aus dem KZ Sachsenhausen an seine Familie geschrieben hat.
Sein Lebensmut und der Beistand seiner Familie halfen ihm, dem Tod zu entkommen. Denn laut nicht
endgültiger Angaben sind von 60 litauischen Kulturträgern aus dem Memelland nur weniger als die Hälfte
aus den Gefängnissen und KZ zurückgekehrt.
Nach Ende des 2. Weltkrieges fand er seine Familie in Wernigerode. Sie hegten den Wunsch, nach Memel
zurückzukehren. Aber die neuen Machthaber der sowjetischen Besatzungszone hatten ihnen die Erlaubnis
verweigert. Ungeachtet seines angegriffenen Gesundheitszustandes fing M.Šlaža wieder an, pädagogisch
zu arbeiten. Er lehrte als Dozent in Fortbildungskursen für Neulehrer, war als Schulleiter in Dardesheim
und dann als Schulrat im Kreis Wernigerode und ab 1952 als Schulrat in Zerbst beschäftigt.
Sein weiteres Leben wurde durch den sich immer verschlechternden Gesundheitszustand infolge seines
KZ-Aufenthaltes geprägt. Er musste seine Arbeit beenden.
Unmittelbar nach der Befreiung aus dem KZ Sachsenhausen hat er sein letztes Werk – die
Lebenserinnerungen unter dem Titel „Bestien in Menschengestalt“ - geschrieben.
Im Oktober 1945 hörte M.Šlaža im Radio einen Vortrag über die Ereignisse am 11.10.1944 im KZ
Sachsenhausen. Er wandte sich an den Sender mit der Bitte, ihm die Namen der 27 ermordeten Häftlinge
mitzuteilen. Er wollte dieses Material in seinem Buch verwenden. Mit Schreiben vom 26.10.1945 wurden
ihm vom Magistrat der Stadt Berlin die Namen der 27 Ermordeten mitgeteilt . Leider hat er aber dieses
Material in seinem Buch nicht verarbeitet.
Mikas Šlaža hat mehreren Verlagen sein Buch zur Veröffentlichung angeboten, so z.B.
am 21.08.1945 dem Verlag „Neue Zeit“ Berlin;
am 10.09.1945 dem Hermann-Schroedel -Verlag Halle a.S.;
am 27.10.1945 dem Verlag Westermann Braunschweig;
am 18.04.1946 dem Verlag Kiepenheuer Weimar.
Alle diese Verlage lehnten entweder wegen Papiermangel, oder „weil es sich um ein politisches Werk
handelt“ die Veröffentlichung ab. Spätere Angebote an Verlage in der DDR wurden aus fadenscheinigen
Gründen abgelehnt, oder man war nur zur Herausgabe einer gekürzten Fassung als Broschüre bereit.
M.Šlaža ist am 3. September 1955 verstorben.
Die Jacke und die Hose seines Häftlingsanzuges mit der Nummer 38541, sowie die
Metallmarke/Erkennungsmarke und zwei Ersatzhäftlingsnummern 38541 wurden von Frau Ruta
Kauffmann (geb. Szlaža) dem Todesmarsch-Museum in Wittstock übergeben.
Zur Wiedereröffnung des Todesmarsch-Museum im Belower Wald am 16.04.2010 wurden die
Erinnerungen von KZ-Häftlingen an die Qualen des Todesmarsches auf Schautafeln dargestellt. Darunter
war auch eine Passage aus dem Buch von Mikas Šlaža.
Der Pädagoge des Memellandes und Kulturschaffende Litauens Mikas Šlaža (1897-1955) ist in Litauen
gut bekannt. Die Wissenschaftler schätzen von ihm geschriebene Lehrbücher für die litauische Schule im
Memelland und auch sein bis heute populäres Deutsch-Litauisches Wörterbuch (1932) sehr hoch. Mikas
Šlaža wird in jeder litauischen Enzyklopädie erwähnt. Die Persönlichkeit und das Wirken von Mikas Šlaža
wird auch weiter erforscht.
Quellen :
- Dokumente aus dem Nachlass von Mikas Šlaža
- Nachwort von Prof. Dr. Domas Kaunas zum Buch „Bestien in Menschengestalt“